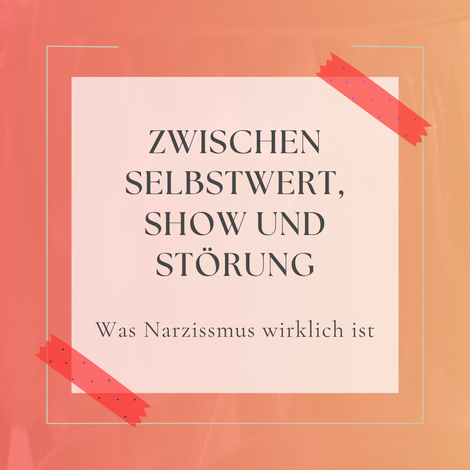
"Der ist doch narzisstisch!"
Diese Worte können heute alles bedeuten: Eitelkeit, Egozentrik oder emotionale Kälte. Narzissmus ist zum Alltagsbegriff geworden und zum moralischen Etikett. Wer viel von sich hält, wird verdächtigt. Wer nicht bedingungslos anderen in den Allerwertesten kriecht, erst recht. Dabei ist Narzissmus streng genommen kein Schimpfwort und sollte keine Mode-Diagnose sein. Narzissmus ist ein psychologisch komplexes Spektrum zwischen funktionaler Selbstwertregulation und tiefgreifender Störung.
Daher fand ich es an der Zeit für eine differenzierte Betrachtung.
Narzissmus ist eine Dimension
In der wissenschaftlichen Psychologie ist Narzissmus keine Diagnose, sondern zunächst einmal ein Persönlichkeitsmerkmal. Es beschreibt das Bedürfnis, den eigenen Selbstwert durch Anerkennung, Einfluss, Status oder Bestätigung zu stabilisieren. In gewissem Maß ist Narzissmus also normal und kann sogar hilfreich sein: Menschen mit gesunden narzisstischen Anteilen wirken oft selbstbewusst, zielstrebig und überzeugend. Sie kennen ihren Wert, ohne ihn ständig beweisen zu müssen. Prinzipiell ist es daher durchaus gesund und in unserer Gesellschaft definitiv zuträglich, narzisstische Eigenschaften zu besitzen.
Problematisch wird es, wenn das Selbstwertgefühl nicht stabil von innen, sondern ständig von außen gestützt werden muss. Dann entsteht das Spannungsfeld zwischen Grandiosität und Verletzlichkeit, was ein Kernmerkmal narzisstischer Muster ist.
Subklinischer Narzissmus
Der sogenannte subklinische Narzissmus ist weit verbreitet. Studien schätzen, dass 15% bis 25% der Bevölkerung ausgeprägtere Züge davon zeigen. Weil so viele Menschen in diesen Bereich des Narzissmus-Spektrum fallen, hören wir mittlerweile so häufig von “Narzissten” und der Boom dieses Begriffs ist daher kein Wunder.
Subklinische Narzissten sind oft leistungsorientiert, selbstbewusst und durchaus charmant. Sie sind oft stressresistenter und nehmen häufiger Führungsrollen ein. Wenn jedoch Empathiedefizite, Mikroaggressionen im Alltag und Empfindlichkeit gegenüber Kritik ausgeprägt sind, wird die Sache dysfunktional. Dann sind Menschen mit subklinischen Narzissmus-Merkmalen unzufriedener in Beziehungen, reagieren mit Aggression und unethischem Verhalten.
Typisch für dieses Narzissmussprektrums sind:
- Überhöhter Selbstfokus
- Geringe Kritikfähigkeit
- Bedürfnis nach Status, Einfluss, Sichtbarkeit
- Tendenz zur Idealisierung oder Entwertung anderer
Im Berufsleben können diese Eigenschaften zu Erfolg führen. In Beziehungen hingegen wird es oft schwierig, weil Nähe und Verletzlichkeit für diese Menschen bedrohlich fürs Selbstbild sind. Konflikte eskalieren häufig und die Partnerperson soll eher Spiegel als Mensch mit Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen sein.
Pathologischer Narzissmus - ein anderes Level
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) ist eine klinisch diagnostizierbare Störung nach ICD-11 und DSM-5 und definiert das pathologische Extrem des Narzissmus-Spektrums. Leider haben sich keine Begrifflichkeiten durchgesetzt, die die Differenzierung ermöglichen (was auf einem Spektrum auch nur bedingt sinnvoll ist). Daher sind Zeitschriftenartikel, Social Media Beiträge und Äußerungen von Laien nicht präzise und es kommt zu Vermischung und Verwechslung bei der Beschreibung von Personen.
Oft gehen Personen davon aus, dass ihr Gegenüber pathologisch narzisstisch ist. Natürlich KANN das der Fall sein. Den Zahlen nach ist es jedoch wahrscheinlicher, dass wir einem subklinischen Narzissten gegenüberstehen als einem Menschen mit einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung.
Diese betrifft “nur” etwa 1% der Bevölkerung, wenn man die Punktprävalenz betrachtet (Punktprävalenz: Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Krankheit leiden). Manchmal liest man auch von 6 %, wobei sich diese Zahl auf die Lebenszeitprävalenz bezieht (Lebenszeitprävalenz: Anteil einer Bevölkerung, der im Laufe seines Lebens an einer bestimmten Krankheit gelitten hat; also Anteil aller Menschen, die während ihres Lebens mal die Merkmale einer NPS aufweisen).
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung bleiben häufig unbehandelt, was den Mythos der unbehandelbaren Persönlichkeitsstörung füttert.
Zentrale Merkmale dieser Störung sind folgende:
- Instabiles, schwankendes Selbstwertgefühl (zwischen Größenfantasie und Selbstverachtung)
- Mangel an Empathie
- Chronisches Anspruchsdenken
- Wiederkehrende zwischenmenschliche Konflikte
- Schwierigkeit, Kritik oder Zurückweisung zu verarbeiten
Unterschied zwischen pathologischem und subklinischem Narzissmus
Der Unterschied zwischen subklinischem und pathologischem Narzissmus liegt nicht nur im Ausmaß, sondern in der Tiefe der psychischen Organisation. Entscheidend sind vier Dinge: Selbstwert, Beziehungsgestaltung, Reflexionsfähigkeit und Funktionalität im Alltag.
Subklinischer Narzissmus bewegt sich auf dem Kontinuum noch im psychologisch „gesunden“ Bereich, auch wenn die negativen Aspekte und deren Folgen für das eigene Leben unbestreitbar sind. Das Selbstbild ist überhöht, aber nicht völlig realitätsfern. Kritik tut weh, wird manchmal trotzdem angenommen. Empathie ist vorhanden, solange sie dem eigenen Selbstbild nicht zu sehr im Weg steht.
Pathologischer Narzissmus – also die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) – ist da schon eine ganz andere Baustelle. Das Selbstwertgefühl ist nicht nur empfindlich, sondern instabil bis zur Identitätsdiffusion: mal größenwahnsinnig, mal tief beschämt. Kritik wird nicht hinterfragt, sondern als existenzielle Entwertung erlebt. Deshalb laufen “gute Ratschläge” und Feedbackgespräche ins Leere oder eskalieren komplett. Daher sind auch Beziehungen schwierig: Nähe triggert Angst, Kontrolle ersetzt Verbundenheit und Schuld liegt immer bei den anderen.
Auch unter den Menschen mit NPS gibt es Betroffene, die einen enormen Leidensdruck haben, weil sie unter der Isolation, die aus den vielen Beziehungsabbrüchen resultieren, leiden. Inwieweit das jedoch für die Mehrzahl gilt, kann man derzeit noch nicht sagen. Die Reflexionsfähigkeit ist aufgrund der Abwehrmechanismen häufig so eingeschränkt, dass Kritik und Feedback nicht ankommen und damit Veränderungen ausbleiben oder erst spät möglich werden.
Kurz: Subklinischer Narzissmus ist unangenehm, aber oft noch regulierbar. Pathologischer Narzissmus ist tiefgreifend.
Grandios oder vulnerabel? Zwei Gesichter des Narzissmus
Um noch eine Schippe Komplexität drauf zu tun, kommt hier noch ein wichtiges Detail, das für meinen Geschmack zu wenig Beachtung findet.
Psychologisch unterscheidet man zwei Hauptformen des pathologischen Narzissmus:
- Grandioser Narzissmus: Dominant, selbstsicher, charismatisch, aber emotional distanziert, kränkbar und oft ausbeuterisch. Dieses Bild entspricht eher dem Stereotyp eines Narzissten.
- Vulnerabler Narzissmus: Äußerlich unsicher, sensibel, zurückgezogen; innerlich aber überzeugt von der eigenen Besonderheit und leicht kränkbar. Diese Erscheinungsform wird häufig von Laien und selbst Betroffenen nicht erkannt.
Was beide Formen verbindet, ist ein instabiler Selbstwert, der durch äußere Bestätigung stabilisiert werden muss. Grandiose Menschen kompensieren durch Überlegenheit, die vulnerablen durch Rückzug, Kränkung oder Opfergefühl. Beide reagieren empfindlich auf Kratzer im Selbstbild, sind dabei allerdings unterschiedlich laut.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Wo wir bei Lautstärke sind. Häufig wird behauptet, dass Männer häufiger von einer NPS betroffen sind als Frauen. Diese Annahme kommt daher, dass Männern die Diagnose häufiger gestellt wird. Neuerdings gibt es jedoch berechtigte Zweifel an dieser Annahme. Die Geschlechterverteilung ist wohl nicht so klar, da der vulnerable Narzissmus häufig übersehen wird.
Hier liegt wohl auch der angenommen größte Unterschied:
- Männer zeigen häufiger grandiosen Narzissmus: Stereotype Männerbilder führen dazu, dass diese Männer seltener als „problematisch“ empfunden werden. Im Gegenteil: Sie scheinen Menschen zu sein, denen man gerne nacheifert. Oft schlägt die Bewunderung um, wenn sie ihre Macht missbrauchen oder Menschen, meist Bezugspersonen, erniedrigen, verletzen oder töten.
- Frauen zeigen tendenziell häufiger vulnerablen Narzissmus: Da sie stärker auf soziale Rückmeldung angewiesen sind, werden sie oft als „überempfindlich“ oder „unsicher“ abgetan, obwohl dieselbe psychologische Struktur dahinter verborgen ist. Fehldiagnosen wie Depression oder Borderline-Persönlichkeitsstörung sind keine Seltenheit. Daher bleiben Frauen mit NPS oft unentdeckt, auch wenn sie ebenso verheerende und vernichtende Auswirkungen auf ihr Umfeld haben wie grandiose Narzissten.
Wie entsteht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Die Entstehung von NPS ist multifaktoriell. Das bedeutet, dass es kein einfaches „Ursache-Wirkung“-Modell gibt. Die Störung entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel von Anlage (biologisch) und Umwelt:
- Moderate Erblichkeit: In Zwillingsstudien zeigte sich, dass es wohl eine gewisse Anlage zum Narzissmus geben könnte. Die Einflussgröße liegt wohl zwischen 40-64%.
-
Frühe Beziehungserfahrungen: Eltern, die ihre Kinder übermäßig idealisieren, tragen dazu bei, dass Kinder grandios-narzisstische Züge entwickeln.
Eltern, die emotional kalt, unberechenbar und instrumentalisierend sind, können im Kind verletzlich-narzisstische Züge begünstigen. - Soziale Einflüsse: Leistungsdruck, Schönheitsideale, gesellschaftliche Überbetonung von Individualität und Erfolg können dazu führen, dass Menschen narzisstische Züge entwickeln.
Kinder von narzisstischen Eltern haben daher sowohl durch ihre Genetik, als auch durch das narzisstische Verhalten ihrer Eltern ein erhöhtes Risiko, selbst narzisstisch zu werden. Gerade wenn Kinder lernen, ihr Selbstwertgefühl nicht durch stabile Bindung, sondern durch Leistung, Bewunderung oder Kontrolle zu regulieren, entwickelt sich daraus eine Strategie, die im Erwachsenenalter zur Störung werden kann.
Gesellschaftliche Trends verstärken die Entwicklung der Störung zum Teil.
Wie erkenne ich narzisstische Züge (bei mir/anderen)?
Wir halten fest: Nicht jeder Mensch mit einem gesunden Selbstbewusstsein ist automatisch narzisstisch. Da narzisstische Verhaltensweisen jedoch viel Leid anrichten können, ist es sinnvoll, bestimmte Muster zu kennen, die auf narzisstische Dynamiken hinweisen können. Dabei ist es egal, ob sie bei uns selbst oder im Gegenüber sichtbar werden. Gerade wenn sie bei uns selbst auftreten, haben wir einen großen Hebel, eigene Beziehungen und die eigene Lebensqualität zu steigern.
Wichtig für die Einschätzung ist dabei nicht das einzelne Verhalten, sondern die Kombination und Wiederholung der Merkmale, vor allem, wenn diese rigide und beziehungsbelastend werden.
Typische Signale:
- Selbstbild: starkes Bedürfnis nach Bewunderung, überhöhte Selbsteinschätzung, Abwehr von Kritik
- Beziehungen: Idealisierung zu Beginn, später Entwertung; Schwierigkeiten mit echter Nähe
- Konflikte: geringe Frustrationstoleranz, Kränkungsreaktionen, Rechthaberei oder Rückzug
- Empathie: Gefühle anderer werden strategisch gelesen, aber nicht mitgefühlt
- Kommunikation: Viel Raum für Selbstdarstellung, wenig Resonanz auf das Gegenüber
Bei sich selbst erkennen: Statt sich sofort zu pathologisieren, lohnen sich die ehrlichen Fragen: Wie reagiere ich auf (berechtigte) Kritik? Brauche ich Bewunderung, um mich sicher zu fühlen/Wie fühle ich mich, wenn ich lange nicht gelobt werde? Kann ich andere sehen und auf sie eingehen? Habe ich echtes Interesse daran, was mir nahestehende Menschen erzählen? Reihen sich bei mir die Datingenttäuschungen, weil sich alle als “Frösche” und nicht als “Prinzessinnen” oder “Prinzen” entpuppen?
Bei anderen erkennen: Wichtig ist, nicht zu diagnostizieren, sondern zu beobachten. Wirkt jemand charmant, aber beziehungsfern (wenig interessiert an dir, nur Kontakt, wenn er/sie etwas von dir will; spricht über sich und seine/ihre Erfolge, es entsteht kein Dialog)? Werden andere hauptsächlich als Bühne, Bestätigung oder Stütze benutzt? Wird Nähe nur dann zugelassen, wenn sie das Selbstbild stärkt? Werden andere nur als “psychischer Mülleimer” benutzt?
Was beide Narzissmus-Typen vereint: der instabile Selbstwert. Grandiose kompensieren durch Überlegenheit, Vulnerable durch Rückzug und Kränkung. Beide reagieren empfindlich.
Was schützt mich – oder andere?
Reflexion, Grenzen, Empathieförderung!
Selbsterkenntnis ist kein Makel, sondern Reife. Wer narzisstische Muster bei sich erkennt, kann sich fragen:
- Wo suche ich Kontrolle statt Verbindung?
- Warum trifft mich Kritik so stark?
- Welche Nähe halte ich aus?
Hilfreich ist Selbstreflexion. Trainiere deine Empathie und suche therapeutische Unterstützung.
Wenn andere narzisstische Muster zeigen, setze klare Grenzen, verzichte auf Therapiespielereien (“Wenn ich ihm/ihr helfe, wird er/sie zur Einsicht kommen”) und fokussiere dich auf Selbstschutz ohne Schuldgefühl.
Ist NPS überhaupt therapierbar?
Dass Therapie für subklinische Narzissten sehr sinnvoll ist, liegt wahrscheinlich auf der Hand. Auch wenn sich immer noch der Mythos hält, dass Persönlichkeitsstörungen nicht therapierbar sind, ist das falsch. Auch NPS können therapiert werden, wobei das für Therapeut*in und Betroffene*n sehr herausfordernd ist.
Menschen mit NPS suchen selten freiwillig Hilfe, weil Selbstkritik schmerzhaft ist und das Störungsbewusstsein oft fehlt. Doch wenn die Motivation da ist, kann Psychotherapie wirksam sein.
Besonders bewährt haben sich:
- Schematherapie: arbeitet an tief verankerten Selbstbildern und Beziehungsmustern
- Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT): fördert die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle differenziert wahrzunehmen
- Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP): nutzt die therapeutische Beziehung als Spiegel dysfunktionaler Muster
Heilung im Sinn der Herstellung eines vollen Verschwindens der narzisstischen Verarbeitungsweise, ist selten, aber Veränderung, mehr Selbstregulation, Empathie und Beziehungsfähigkeit sind realistische Therapieziele.
Warum das Wissen über Narzissmus wichtig ist
Wer Narzissmus versteht, erkennt, dass es nicht um Zuschreibungen oder Abwertung geht, sondern um psychologische Muster, die in uns allen existieren – mal funktional, mal destruktiv. Und es gibt Spielräume. Menschen mit narzisstischen Zügen können lernen, ihren Selbstwert anders zu regulieren. Sie können lernen, mehr Verbindung und Empathie zuzulassen und sich weniger verteidigen und kontrollieren zu müssen.
Aber dafür braucht es Wissen – nicht pauschale Urteile.
Fazit: Narzissmus ist mehr als ein Schlagwort
Narzissmus ist ein psychologisches Spektrum. Keine Beleidigung. Keine Ausrede. Kein Lifestyle.
Entscheidend ist nicht, ob jemand narzisstisch ist, sondern wie bewusst und beziehungsfähig man mit diesen Anteilen umgeht.
Bald folgen dazu weitere Beiträge:
Narzissmus und Dating
Kollektiver Narzissmus
Die häufigsten Mythen über Narzissmus
Insta-Coaches und Narzissmus
